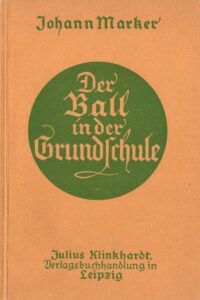Der 1984 im Alter von 87 Jahren in Berlin verstorbene Turnlehrer Johann Marker war seit Ende der zwanziger Jahre ein bekannter Sportautor. Er widmete sich besonders dem Grundschulsport der Kinder und dem Ballspiel, trat aber auch als „Wissenschaftsjournalist“ an die Öffentlichkeit. Mehr als 80 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften sowie fünf Bücher verzeichnen die Bibliografien (s. Anlage). Dazu gehören auch Beiträge zur Sprachwissenschaft und nach dem Krieg zur Berliner und Brandenburger Geschichte. An ihn soll erinnert werden.
Johann Marker wurde am 29. November 1896 in Charlottenburg geboren. Sein Vater Karl Marker war Maurer, seine Mutter Maria, geb. Schöpe, Verkäuferin. Er hatte eine ältere Schwester Margarethe und zwei jüngere  Hedwig und Magdalena, alle waren katholischer Konfession. Die Familie wohnte in der Schillerstr. 79 in Charlottenburg, das damals noch selbständige Stadt war. Er besuchte dort die 242. Gemeindeschule und erhielt 1911 sein Entlassungszeugnis. Noch vor Ausbruch des 1. Weltkrieges zog die Familie nach Fraustadt (heute: Wschowa) in der preußischen Provinz Posen. Dort schrieb sich Johann Marker 1914 in das Königliche Lehrerseminar mit dem Berufsziel des Volksschullehrers ein. 1917 wurde er trotz seiner geringen Körpergröße zum Lehrgang für Kriegsseminaristen einberufen und als Unteroffizier dem Füsilier-Regiment 39 zugewiesen. 1919 folgte seine Entlassung aus dem Wehrdienst. Er setzte das Lehrerstudium in Fraustadt fort und bestand dort im November 1919 die Erste Staatsprüfung. Danach wechselte er nach Berlin-Lichterfelde und erhielt 1920 nach dem Zweiten Staatsexamen das Zeugnis zur Anstellung als Lehrer an Volksschulen.
Hedwig und Magdalena, alle waren katholischer Konfession. Die Familie wohnte in der Schillerstr. 79 in Charlottenburg, das damals noch selbständige Stadt war. Er besuchte dort die 242. Gemeindeschule und erhielt 1911 sein Entlassungszeugnis. Noch vor Ausbruch des 1. Weltkrieges zog die Familie nach Fraustadt (heute: Wschowa) in der preußischen Provinz Posen. Dort schrieb sich Johann Marker 1914 in das Königliche Lehrerseminar mit dem Berufsziel des Volksschullehrers ein. 1917 wurde er trotz seiner geringen Körpergröße zum Lehrgang für Kriegsseminaristen einberufen und als Unteroffizier dem Füsilier-Regiment 39 zugewiesen. 1919 folgte seine Entlassung aus dem Wehrdienst. Er setzte das Lehrerstudium in Fraustadt fort und bestand dort im November 1919 die Erste Staatsprüfung. Danach wechselte er nach Berlin-Lichterfelde und erhielt 1920 nach dem Zweiten Staatsexamen das Zeugnis zur Anstellung als Lehrer an Volksschulen.
In den Hungerjahren und der großen Arbeitslosigkeit entschied er sich für eine Fortsetzung des Studiums. Er besuchte die Preußische Hochschule für Leibesübungen (Landesturnanstalt) in Spandau und machte 1922 nach einjähriger Ausbildung das Diplom als Turn-, Schwimm- und Ruderlehrer. 1923 erhielt er von der staatlichen Prüfungskommission die Befähigung zur Tätigkeit als Mittelschullehrer und besuchte in Spandau Fortbildungen im orthopädischen Turnen. Im staatlichen Lehrerseminar Berlin-Lichterfelde belegte er 1925/26 Ergänzungskurse in Latein und Griechisch, die 1927 zum Reifezeugnis führten. Er war nunmehr bestens für den Schuldienst und ein Universitätsstudium ausgebildet, hatte aber keine Chance auf Anstellung. So immatrikulierte er sich 1926 an der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin, der heutigen Humboldt-Universität.
Turn-Schriftsteller und „Wissenschaftsjournalist“
Während seines Studiums und danach wandte er sich der Publizistik zu. Er schrieb in Fachzeitschriften über historische und sportfachliche Themen und nahm zu aktuellen Fragen der Ausbildung und Erziehung Stellung. Das Spektrum seiner Beiträge reichte vom Schwimmen und Kinderspiel, dem orthopädisches Turnen zur Vermeidung von schlechter Haltung und krummen Rücken, der Unfallverhütung beim Sport bis zur chinesischen Atemgymnastik, den Gefahren von Schulausflügen, der Schulgesundheitspflege und der Häufigkeit von Schülerselbstmorden. In unserem heutigen Internet- und Medien-Zeitalter würden wir ihn als vielseitigen „Wissenschaftsjournalisten“ bezeichnen. Zu den von ihm bevorzugten Fachzeitschriften zählten „Die Mittelschule“, „Die neue deutsche Schule“, „Die Volksschule“, die „Kath. Monatsschrift Pharus“, „Die pädagogische Warte“, die „Vierteljahreshefte für Jugendkunde“ und die „Wiener Zeitschrift für Sprachstudien“. Als Turnphilologe veröffentlichte er seine Beiträge auch in den einschlägigen Sportzeitschriften, so der Zeitschrift des Turnlehrerverbandes „Deutsches Schulturnen“, den „Blättern für Volksgesundheitspflege“ und der Zeitschrift „Leibesübungen und körperliche Erziehung“. Er war regelmäßiger Autor der von der Deutschen Turnerschaft herausgegebenen „Deutschen Turnzeitung“, bei Durchsicht deren inzwischen digitalisierten Ausgaben stößt man oft auf seinen Namen. So berichtete er über hellenistische Agonistik, die täglichen Leibesübungen im 4. Jahrhundert, die Verbindung des Erlernens der deutschen Sprache in Chile durch Turnübungen bis zu seinem Lieblingsthema über das Spiel der Kinder und den „unsterblichen“ Ball. Auch meldete er sich zur Verwendung von angelsächsischen und deutschen Wortschöpfungen wie Start und Fair zu Wort und setzte sich mit dem „Folkloristischen“ in den Volks- und Jugendspielen auseinander. Nach 1933 – in den Jahren der „Hitlerei“ wie er es ausdrückte – hielt er sich mit Veröffentlichungen zurück. Sein letzter Beitrag erschien 1936 im Organ des Erziehungsministeriums „Leibesübungen und Körpererziehung“ unter dem Titel „Der griechische Arzt Galen und das Ballspiel“ und nahm Bezug auf seine Übersetzung des ersten Ballspielbuches aus dem Jahr 1932. Ein im Olympiajahr geschriebener Beitrag „GutsMuths als Familienvater“ wurde von der auf NS-Kurs befindlichen „Deutschen Turnzeitung“ mit dem Grund zurückgewiesen, „er sei ein Thema für einen Professor, nicht für einen Turnlehrer“. Der Artikel ist 25 Jahre später 1964 in der Zeitschrift „Die Leibeserziehung“ erschienen.
Marker als Buchautor und Sportschriftsteller
Ausgangs der zwanziger Jahre trat Johann Marker als Buchautor an die Öffentlichkeit. Sein erstes Buch „Das Spielturnen der Schulanfänger“ erschien 1928 im angesehenen Limpert-Verlag. Der Direktor des Waisenhausen der Stadt Berlin, Paul Goltz, gab dem Buch sein Geleit und wies auf die pädagogisch-methodischen Fortschritte der Weimarer Zeit hin und lobte die von Marker beschriebenen neuzeitlichen Anforderungen an Grundschulkinder. Das „Preußische Volksschularchiv“ schrieb darüber: „Das aus der lebendigen Praxis heraus entstandene Büchlein ist als eine wesentliche Förderung der Arbeit in der Grundschule anzuerkennen, indem es, das Spiel als Hilfsmittel benutzend, allmählich hinüberleitet zu ernster Schularbeit. In der Auswahl der Spielformen ist mit Geschick und Glück überall auf den kindlichen Gedankenkreis eingegangen, um die innere Mitbeteiligung bei den Kindern auszulösen. Es ist allen beteiligten pädagogischen Kreisen, den Schulräten, Rektoren, Lehrern und den Verwaltungen der Kindergärten zu empfehlen.“ Markert wurde als Turnschriftsteller bekannt.
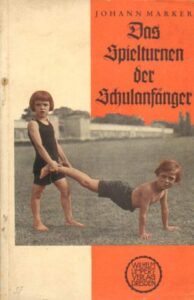
Ebenfalls bei Limpert wurde 1930 sein Buch „Die Seele des Kindes im Turnspiel“ verlegt. Er stellte mit dem Begriff Seele die Gesamtpersönlichkeit des Kindes in den Mittelpunkt und beschäftigte sich mit den Leibesübungen in Bezug auf Fragen der Pädagogik, Psychologie und Philosophie, vornehmlich auch unter dem Aspekt des Kinderspiels. Zu seinen Erkenntnissen zählten auch Vergleiche mit anderen Ländern, so Russland, Japan und China. Prof. Dr. Eugen Matthias, Biologe und Leiter des Instituts für Leibesübungen der Universität München, lobte Marker als Turnlehrer, Methodiker und guten Beobachter: „Wieder überrascht uns der Verfasser mit einer reizenden Arbeit. Ein guter Kenner der Kinderseele hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Seele des Kindes im Spiel zu studieren. In sinniger und doch schlichter Weise erzählt er uns seine im Spiel der Kinder gemachten Beobachtungen. Da, wo sich scharf gegliederte, sauber aufgebaute Methodik und psychologisches Feinverständnis für die Seele des Kindes zusammenfinden, da muss ein gedeihlicher Unterricht entstehen, da muss jeder – vorab der Turnunterricht – für die Kinder eine Arbeit im Gewande jugendlicher Freude werden.“
Das 88-seitige Werk sagt viel über Marker selbst und seine Berufung als Lehrer aus. Wer heute über Foulspiel im Fußball (und der Gesellschaft) diskutiert, sollte sich Markers Aussagen von 1930 in Erinnerung rufen: „Besondere Obacht wird man den Lügen im Spiel widmen, die aus Parteiinteresse begangen werden. Sie erinnern an die heroischen Lügen, die einem gewissen Edelmut und Rittersinn entspringen und den Freund vor Strafe bewahren wollen. Bei den Lügen aus Parteiinteresse will man auch den Spielfreund der eigenen Mannschaft decken und vor allem sich einen Vorteil zuschanzen. Hier hilft in der größten Mehrheit der Fälle nur eins, nämlich den Kindern die Schädlichkeit der Lügen aus falschem Heroismus und verderblichen Parteifanatismus für das spätere Leben recht eindringlich zu Gemüte zu führen: der Lügende macht hier den Freund zum Mitschuldigen, hindert dessen Geständnis und damit seine Besserung und macht ihm Mut zu erneutem, unerlaubtem Tun, das ihn in Gefahren bringen kann. Er zerstört sich selbst das Vertrauen, das er in seiner Umgebung genießt.“ Was für eine aktuelle pädagogische und politische Aussage.
Keinen Verlag fand er 1932 für die Übersetzung der berühmten Schrift von Claudius Galen (129 – 216 n.Chr.) aus dem Griechischen „Die Leibesübung mit dem kleinen Ball“, des ersten Ballspielbuchs der Welt. Das Buch – heute eine antiquarische Rarität – veröffentlichte er im Selbstverlag, also auf eigene Kosten. Die Zeitschrift „Leibesübungen und Körpererziehung“ kommentierte vier Jahre später die Publikation mit den Sätzen: „Die Übersetzung hat im Jahr der Olympischen Spiele besondere Beachtung verdient. Was der Übertragung ihren besonderen Wert verleiht, sind die zahlreichen und aufschlussreichen Erklärungen, die Johann Marker dem Text beigegeben hat. Die wohlgelungene Übersetzung der berühmten Schrift, deren Inhalt vielfach ganz modern anmutet, lässt uns wieder einmal mehr bedauern, dass uns so wenige derartige Abhandlungen aus der Antike erhalten geblieben sind.“
Galen hatte als Arzt stets vor der körperlichen Überanstrengung der Athleten gewarnt, nahm aber die von ihm beschriebenen „Übungen mit einem kleinen Ball“ mit den Worten davon aus „Sport könnte der Gesundheit zuträglich sein, sofern er mit Mäßigung betrieben würde“. Darauf ging Marker in seiner Kommentierung ein. Das NS-Erziehungsministerium veröffentlichte 1936 Galens Ballspielbuch ohne die Markerschen Erläuterungen und in neuer Übersetzung durch Kurt Schütze, einen im Gegensatz zu Marker ‚diplomierten‘ Übersetzer. Der Neudruck durch den Verlag der Weidmannschen Buchhandlung war für die Studenten der neu geschaffenen „Reichsakademie für Leibesübungen“ bestimmt.
Im Jahr 1932 folgte im Leipziger Julius Klinkhardt-Verlag Markers Buch: „Der Ball in der Grundschule – ein Schöpfer froher Stunden“. Auf 42 Seiten stellte er 47 Spiele mit großen und kleinen Bällen in Form von Wettkampf-, Wurf-, Fang- und Neckspielen für den Unterricht in den Klassen eins bis vier der Grundschulen vor. Eine Übungssammlung, die auch heute noch Grundschulkinder im Sportunterricht erfreuen würde. Dr. Carl Diem, der Generalsekretär des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen, gab dem Buch das Geleit und lobte es als Abkehr von Gliederpuppenübungen und Sportunterricht im Sitzen mit den Sätzen: „Das Ballspiel ist ein lebenswichtiger Bestandteil unter Leibeserziehung. In Gottes sonniger Natur in nur leichter Kleidung betrieben, bedeutet es eine ausgezeichnete Freiluftgymnastik für das Kind. Die Vielseitigkeit der Bewegungen, die das Spiel mit dem „kleinen kugeligen Ding“ willkürlich oder unwillkürlich auslöst, übt und stählt den ganzen jugendlichen Körper. Zugleich weckt es Entschlossenheit und Tatkraft, Frohsinn und Heiterkeit. Diese Freudengymnastik lässt die Kleinen wenigstens für eine Zeit das sonst so wichtige schulische Drum und Dran vergessen. Das Ballspiel ist – um es kurz herauszusagen – für unsere Schuljugend ein in gleicher Weise Körper und Geist erfrischender Born. Ein Mann, der die Jugend kennt und liebt und mitten in der Praxis steht, hat hier ein recht brauchbares Ballspielbuch für die einzelnen Jahrgänge der Grundschule geschaffen, ein Buch, das bisher noch gefehlt hat.“
Eine weitere Veröffentlichung fand keinen Verleger und wurde wieder – wie Galens Ballspielschrift – von Marker 1935 im Selbstverlag herausgegeben:
Er nannte das Buch „Das Schwimmen der Zaghaften und Ängstlichen“. Georg Hax, jetzt „Führer“, früher Vorsitzender der Säule V des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen – Schwimmen und Lebensrettung – lobte die kleine Schrift im Geleitwort: „Ein Büchlein, das sich so ausschließlich mit der Schwimmunterweisung Zaghafter und Ängstlicher befasst, hat bisher gefehlt. Hier erlernt er Entschlusskraft, Mut und Ausdauer, alles Eigenschaften die dem Menschen helfen, die Schwierigkeiten auf dem Lebensmeere zu überwinden.“ Hax war als Schwimmfunktionär und ehemaliger Europameister im Turmspringen und Wasserball-Nationalspieler eine Koryphäe im Schwimmsport. Marker stellte in seiner Schrift die Überwindung von Hemmungen und die behutsame Vorbereitung des Schwimmenlernens in den Vordergrund und ging besonders auf das in Notlagen günstigere Rückenschwimmen ein. Seine Beschreibungen für die Zaghaften und Ängstlichen enthielten eine Fülle von Übungsbeispielen bis hin zum Wasserspringen und Schwimmen im Tiefen.
Es war seine letzte Veröffentlichung in der NS-Zeit. Markers an Pestalozzi und Fröbel sowie dem „Natürlichen Turnen“ orientierte liberale Kindererziehung passte nicht in die neuen Vorgaben der Nationalsozialisten, schon den Kleinsten im Kindergarten und in der Grundschule „kräftige Körper“ und „tiefe Führerliebe“ zu verordneten, was sie „Revolution der Erziehung“ nannten. Dazu gehörte auch eine Neu-Interpretation von Jahn und Fröbel als „politische Volkserzieher“, die Markers Konzept einer freudvollen und vor allem individuellen Kindererziehung durch Sport und Spiel entgegenstand. Es ist im Nachhinein zu bedauern, dass sich die Erziehungs- und Sportwissenschaft im „Jahrhundert des Kindes“ bisher nicht mit der Geschichte des Kinderspiels, speziell der Bewegungserziehung und dem Sport der Kleinsten beschäftigt hat. Dazu gibt es nur wenige historische Einzeluntersuchungen aus der Kaiserzeit, der Weimarer Republik, der NS-Diktatur sowie der Nachkriegssysteme in Ost und West vor. Ein Desiderat der Geschichtswissenschaften.
Grundschullehrer in Berlin
Neben seiner Tätigkeit als Autor schloss Marker sein Studium an der Berliner Universität ab und fand 1931 an der 30. Volksschule in Berlin-Lichtenberg in der Auguste-Viktoria-Straße in Karlshorst seine erste Anstellung als Vertretungslehrer im Turnen. Es folgten befristete Tätigkeiten an Katholischen und Städtischen Volksschulen in Tiergarten (Stephanstr. 58), Neukölln und Schöneberg (Tempelhofer Weg 62). Von 1935 bis 19337 bereitete er sich auf eine Festanstellung im Schuldienst vor und belegte die dafür notwendigen Kurse in Erster Hilfe, im Schulschwimmen und als Schmalfilmvorführer. Am 1. März 1937 trat er als beamteter Lehrer an der 14. Volksschule in Berlin-Spandau offiziell in den öffentlichen Dienst ein. 1938 wechselte er an die 200. Volksschule in Berlin-Prenzlauer Berg in der Oderberger Straße, dem heutigen Campus der GLS-Sprachschulen.
Zum 1. Juni 1939 wurde er in den Ruhestand versetzt. Gründe dafür sind nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er zur Pflege seiner psychisch kranken Mutter Maria, mit der er in der gemeinsamen Wohnung in der Flensburger Str. 27 lebte, seinen Beruf aufgab. Der Vater war schon Jahre zuvor in Landsberg/Warthe verstorben. Seine Mutter starb 1940 in den Wittenauer Heilstätten, als Todesursache wurde auf der Sterbeurkunde „Jugendirresein/Lungenentzündung“ vermerkt. Ihren Tod meldete mündlich ein beim Standesamt bekannter Mitarbeiter der größten Berliner Nervenklinik, die tief in das Euthanasie-Programm des NS-Staates verstrickt war. Ihr Name ist in den offiziellen Opferlisten nicht verzeichnet. Im Berliner Adressbuch von 1943 erscheint Johann Marker als „Lehrer a.D.“ mit der nunmehr bis zu seinem Tod aktuellen Anschrift Wetzlarer Straße 24 in Wilmersdorf. Hier sind noch biografische Lücken zu schließen. Johann Marker hat nie über seine Mutter gesprochen. Dass er kein Nazi war, hat das Bundesarchiv 2023 bestätigt.
Turnhistoriker und Heimatforscher
Nach 1945 bezog Marker Versorgungsbezüge des Magistrats von Groß-Berlin und widmete sich verstärkt seinen sporthistorischen und jetzt auch heimatkundlichen Forschungen. Anfang der sechziger Jahre trat er in Kontakt zur Landesgeschichtlichen Vereinigung der Mark Brandenburg und arbeitete mit Prof. Dr. Werner Vogel, dem späteren Direktor des Preußischen Geheimen Staatsarchivs, zusammen. Kontakte und Korrespondenz gab es auch mit dem Verein zur Geschichte Berlins sowie dem Wiener Sprachforscher und Turnhistoriker Prof. Dr. Erwin Mehl. Marker war ehrenamtlicher Mitarbeiter der „Zeitschrift der Pflege der deutschen Sprache“. Auch beschäftigte er sich mit literarischen Forschungen, so ging er zusammen mit seiner Schwester Hedwig, mit der er zusammenlebte, dem bei Theodor Fontane in dessen Autobiografie „Von zwanzig bis dreißig“ genannten „Schulrat Methfessel“ nach. Eine Briefkopie der Stadtbibliothek zeigt, dass beide wegen weiterer Nachforschungen an die in Ost-Berlin befindlichen Archive verwiesen wurden.
Seine heimatkundlichen Veröffentlichungen erschienen im Jahrbuch der Vereinigung für Brandenburgische Landesgeschichte sowie auch im Mitteilungsblatt des „Vereins für die Geschichte Berlins“.
Dazu gehören auch die von Marker aus dem Jahrbuch in Auftrag gegebenen Sonderdrucke, die er seinem weit über Berlin hinausreichenden Bekanntenkreis mit der Bitte um Diskussion zugänglich machte:
Die heilige Gertrud von Berlin (1975)
Die Geschichte der Preußischen Hochschule für Leibesübungen in Spandau (1977)
Ernst von Pfuels Leben und Wirken in Berlin (1979).
Marker schrieb regelmäßig für die Sportfachzeitschriften „Die Leibeserziehung“, „Deutsches Turnen“ und „Berliner Turnzeitung“. Er wies auf Gedenkstätten und Erinnerungstafeln des Sports hin und widmete sich Einzelpersönlichkeiten, so GutsMuths, Jahn, Eiselen, von Pfuel, Engelbach, Harnisch, von Schenkendorff, von Goßler, Fröbel und Diem. Wie in den zwanziger Jahren beschäftigte er sich mit historischen Epochen, so dem altgriechischen Gymnasium, der Geschichte des Berliner kurfürstlichen Ballhauses und den seit 1896 stattfindenden modernen olympischen Spielen.
Verdienste um Berliner Ehrengräber
Besondere Verdienste erwarb sich Johann Marker um die Pflege historischer Grabstellen auf den alten Kreuzberger Friedhöfen und der Einrichtung von Ehrengrabstätten für berühmte Persönlichkeiten. Berichte in den Tageszeitungen machten ihn als Heimatforscher bekannt, wenn er sich erfolgreich für die Einrichtung neuer Ehrengrabstellen eingesetzt hatte.
Zu den von ihm beantragten und durchgesetzten Ehrengräbern für Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Sport gehörten:
Dr. Hans Brendicke (1850-1925), Turnphilologe und Heimatforscher (1970)
Moritz Fürbringer (1802-1874), Stadtschulrat und Stadtältester (1970)
August C.F. Hoffmann (1776-1858), Stadtältester und unbesoldeter Stadtrat (1971)
Prof. Christian A. Gareke (1819-1904), Botaniker (1973)
Friedrich W.G. Büxenstein (1857-1924), Buchdrucker und Förderer des Ruder-, Segel-, Pferde- und Automobilsports (1975)
Prof. Dr. Joachim Tiburtius (1889-1967), Senator für Volksbildung (1975)
Melli Beese (1886-1925), Motorfliegerin und Weltrekordlerin (1975)
Prof. Dr. Johannes Schultze (1881-1978), Nestor der brandenburgischen Geschichtsschreibung (1975)
Kurt Pomplun (1910-1977), Heimatforscher und Rundfunkmoderator (1978)
Prof. Dr. Edwin Redslob (1884-1973), Reichskunstwart, Mit-Gründer der Freien Universität Berlin und der Zeitung DerTagesspiegel (1980)
Im Jahr 1982 berichteten die Bild-Zeitung und die Berliner Morgenpost über seine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Bild titelte „Berliner Germanist: Seit über 10 Jahren sorgt er dafür, dass berühmte Tote Ehrengräber bekommen“ (4.2.82) und die Berliner Morgenpost schrieb über Melli Beese „Das fliegende Mädchen in der hölzernen Kiste“ (31.1.82). Marker hatte für Beeses Ehrengrab zweieinhalb Jahre mit Eingaben und Unterschriftensammlungen gekämpft. Ein erster Antrag des Deutschen Aero-Clubs war abgelehnt worden, ein erneuter vom Landessportbund unterstützter Antrag führte dann 1975 zum Beschluss des Senats über ein Ehrengrab. An den Kosten des Grabsteins für Melli Beese hat sich Johann Marker mit einem namhaften Beitrag beteiligt, wofür ihn der Bezirksbürgermeister von Wilmersdorf herzlich dankte. Gertrud Pfister, langjährige Vorsitzende des Berliner Forums für Sportgeschichte, hat 1989 Melli Beese in ihrem Buch „Fliegen – ihr Leben: Die ersten Pilotinnen.“ ein Denkmal gesetzt. Inzwischen wurde ihr dramatisch-tragisches Leben auch verfilmt.
Marker kämpfte auch für die Verlängerung des Ehrengrabes von Dr. Hans Brendicke, des Heimatforschers, Turnhistorikers und Ehrenmitgliedes der Deutschen Turnerschaft, den Marker als eines seiner großen Vorbilder bezeichnete. Sein Grab mit Stele und Bronzebüste liegt nicht weit entfernt vom Stresemann-Grab auf dem Luisenstädtischen Friedhof am Kreuzberger Südstern (s. Abb.). Es wurde von Marker regelmäßig mit Wassereimer, Bürste und Handfeger gereinigt. Brendicke war in Berlin neben seinen historischen Arbeiten eine markante, ja stadtbekannte Erscheinung: Er führte Touristen und Geschichtsinteressierte jeden Sonntag durch die Berliner Altstadt und war dabei mit Gehrock und Zylinder bekleidet, in Ehrfurcht vor der Geschichte Berlins. Gerd Steins hat 2023 über Brendicke in Münster referiert und sich 2020 erfolgreich für eine weitere Verlängerung des Ehrengrabes eingesetzt, er ist damit in die Fußstapfen von Johann Marker getreten. Er hat mich übrigens dazu angeregt, dem Lebenslauf Markers nachzuspüren.
Ein von Marker 1980 erstelltes Typoskript „Was ich für die Erhaltung von Grabstätten verdienter Persönlichkeiten in Berlin tat“ liegt in den Archiven der Landesgeschichtlichen Vereinigung und des Landessportbundes.
Persönliche Begegnungen
Ich lernte Johann Marker Ende der sechziger Jahre im alten Haus des Sports am Bismarckplatz kennen. Er kam regelmäßig zu Besuchen vorbei, brachte Fotos und Dokumente mit und tauschte sich über historische Themen aus. Hin und wieder bat er um Mithilfe bei der Veröffentlichung seiner Beiträge in Fachzeitschriften. Er beschäftigte sich mit der Traditionspflege, den Erinnerungsstätten des Sports in Berlin und besonders mit GutsMuths, Turnvater Jahn und dem Schwimm-General und späteren preußischen Ministerpräsidenten Ernst von Pfuehl.
1973 erbat er ein Foto vom Turnfestdenkmal von 1968, das im Rathaus Schöneberg lagerte und im neuen Turnzentrum aufgestellt werden sollte. Es zeigte eine moderne Nachbildung des Turnplatzes in der Hasenheide in Bronze in einer Größe von 1,50 x 1,50 Meter. Auch an der vom Berliner Turnerbund 1978 zum Deutschen Turntag herausgegebenen Erstausgabe „Die Berliner Hasenheide. Ihre Turnplätze von 1811 bis 1934“ nahm er regen Anteil und korrespondierte mit dem Autor Gerd Steins, der damals noch Student war. 1980 stellte er in „Deutsches Turnen“ die Jahnbüste am Wohnhaus Hasenheide/Ecke Jahnstraße an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg vor. Auf Grund seiner Anregung wurde sie 1979 von der Berliner Denkmalpflege restauriert. Im gleichen Jahr sorgte er beim Bezirksamt für die Restaurierung einer Gedenktafel an der ehemaligen Plamannschen Erziehungsanstalt im Kreuzberger Teil der Wilhelmstraße. Jahn und Eiselen hatten dort unterrichtet, der berühmteste Schüler war Bismarck. Sein Bericht erschien in der „Berliner Turnzeitung“ und in Kurzfassung im Berliner Baedecker.
Zum 75. Geburtstag besuchte ich ihn 1971 in seiner Wilmersdorfer Wohnung. Seine Schwester hatte Kuchen gebacken und er war stolz auf seine Besucher. Es waren nur drei, Dr. Werner Vogel von der Landesgeschichtlichen Vereinigung Brandenburg, ein Nachbar und ich, damals als Vertreter der Turnerbundes. Es gab anregende Diskussionen und er zeigte eine große Blumenschale, die ihm das Bezirksamt zum Geburtstag als Dank für ehrenamtliche Grabpflege auf den Kreuzberger Friedhöfen geschickt hatte.
Seit 1971 arbeitete er an einem Beitrag über „GutsMuths und seine drei berühmten Erdkundeschüler Prof. Karl Ritter, Heinrich Graf von Görtz und Dr. Alexander Ziegler“, den er mir für eine Veröffentlichung übergab. Besonders stolz war er über die von ihm erforschte Verbindung von GutsMuths mit Karl Ritter, dem Träger des „Pour le Merite“ für wissenschaftliche Verdienste. Ich hatte Schwierigkeiten, den sehr langen Beitrag nebst Bildmaterial unterzubringen und Marker ließ nicht nach, mich hartnäckig an dessen Veröffentlichung zu erinnern. 1980 wurde der Artikel in der Berliner Turnzeitung und in einer gekürzten Version in der Festschrift des TSV GutsMuths von 1861 abgedruckt. Der Autor war zufrieden.
1978 konnte ich ihn bei der von ihm gewünschten Restaurierung des Spandauer Jahn-Denkmals vor der ehemaligen Preußischen Hochschule für Leibesübungen (heute Polizeiakademie, zuvor Britisches Militärkrankenhaus und in der NS-Zeit Napola) unterstützen. Er hatte dazu eine Eingabe an das Bezirksamt gerichtet und sich durch den hochbetagt in Dortmund lebenden Rudolf Freund, Oberturnrat der früheren Landesturnanstalt, beraten lassen. Leider standen dem Bezirk im Jahr des 200. Geburtstags von Jahn keine Verfügungsmittel für die Restaurierung zur Verfügung. Marker war enttäuscht und bat mich um Unterstützung bei mir vertrauten Partnern auf der Zitadelle, Sportstadtrat Schleusener und Landeskonservator Prof. Dr. Engel. Im Ergebnis wurden die Inschriften des Spandauer Jahn-Denkmals aus Restmitteln restauriert. Marker bekam ein offizielles Dankschreiben des Baustadtrates Behrendt mit einem von der Bezirksbildstelle – so etwas gab es damals noch – aufgenommenen Foto. Er war begeistert und rief mich vom Telefon eines Nachbarn an. Neben seinem Dank drückte er großes Bedauern aus, das Denkmal in der Radelandstraße wegen seines schlechten Gesundheitszustandes nicht selbst besuchen zu können. Er wäre auch gern mit mir auf den Juliusturm der Zitadelle gestiegen und hätte sich das neue Bildungszentrum der Sportjugend auf der Bastion Brandenburg angesehen, das wären alles auch Erinnerungen an seine Spandauer Studien- und Lehrerzeit. Es war das einzige Telefonat und der letzte persönliche Kontakt zwischen uns.

Johann Marker im Alter von 80 Jahren
Seit 1979 verließ er seine Wohnung nicht mehr und bat alle, ihn nicht mehr zu besuchen. Anfang 1982 teilte er mir den Tod seiner Schwester Hedwig mit, die bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Er schrieb „Ich bin jetzt allein. Das ist Gottes Wille. Aber es gibt ja die Post, die uns in Verbindung hält.“ Fortan kamen regelmäßig seine eng beschriebenen Postkarten, in denen er Fragen stellte oder seine Forschungen erläuterte. Auch in berühmten Nachlässen, wie denen von Carl Diem und Erwin Mehl in Köln und Josef Göhler in Berlin, sind seine Postkarten zusammen mit säuberlich auf A 5 geschriebenen Briefen zu finden. Er kommunizierte bis zu seinem Tod mit vielen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Sport, Erziehung, Sprach- und Heimatkunde, und zwar weit über Berlin hinaus. Ein universell gebildeter und interessierter Turnphilologe im zu Ende gehenden 20. Jahrhundert.
Seine letzte gute Tat teilte er mir mit dem Ostergruß für 1984 mit: In Heidelberg war gerade eine Gedenktafel für Dr. Karl Wassmannsdorf (1821-1906), dem bekannten Turnlehrer und Historiker, enthüllt worden. Am Text der Tafel hat er, wie er mitteilte, maßgeblich mitgearbeitet. Das war im April 1984.
Wenige Wochen später, am 11. Juli 1984, ist er einem Schlaganfall erlegen, Nachbarn haben ihn gefunden. Da weder ein Testament vorlag noch Angehörige bekannt waren, wurde sein Nachlass von Amts wegen aufgelöst und größtenteils entsorgt. Wir erfuhren erst von seinem Tod, als die Berliner Turnzeitung mit der Anmerkung „verstorben“ zurückkam. Professor Dr. Werner Vogel teilte mir seinen Todestag mit. Ich schrieb einen Nachruf in der „Berliner Turnzeitung“ und unterrichtete Dr. Josef Göhler, der bereits nach Marker gefragt hatte. Der Nachlass ist seitdem in alle Winde zerstreut. Gerd Steins hat ein Galenbuch aus Markers Besitz in einem Antiquariat gefunden, der Archivar Dr. Bahl 2000 auf einem Flohmarkt Markers Schul- und Hochschulzeugnisse einschließlich der in Latein geschriebenen Immatrikulations-Urkunde der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin von 1926 für die Landesgeschichtliche Vereinigung erworben (siehe Quellen).
Mit der Bibliothek Markers und seines umfangreichen über Jahrzehnte reichenden Schriftwechsel ist ein für die Sportgeschichtsschreibung großer Schatz verloren gegangen. So können an dieser Stelle nicht alle Lebensstationen objektiv rekonstruiert und müssen durch persönliche Anmerkungen ersetzt werden. Aus heutigem Wissen wären Hinweise auf seine Studienzeit an der Berliner Universität und sein Ausscheiden aus dem Schuldienst kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges interessant. Dafür müssten Dokumente aus dem Archiv der Humboldt-Universität und Personalakten aus dem Landesarchiv herangezogen werden, was in der Nach-Coronazeit noch immer schwierig ist. Dankbar bin ich Dr. Peter Bahl, dem Vorsitzenden der Landesgeschichtlichen Vereinigung der Mark Brandenburg, der mir bei der Recherche und dem Zugriff auf Geburtsurkunden und preußische Lehrerkalender geholfen hat. Mein Dank gilt auch Anja Ludwig von der nach der Wende aus den Ost- und Westbeständen gegründeten „Bibliothek für Bildungsgeschichtlich Forschung (BBF)“, die mir eine Kopie der Preußischen Volksschullehrerkartei von Johann Marker zusandte. Eine Auswertung der Personalbögen der preußischen Volksschullehrer und des seit 1867 angelegten Archivs der „Turnvereinigung Berliner Lehrer“ ist gegenwärtig nicht möglich, da die BBF-Bestände wegen eines Cyberangriffs sowohl online als auch analog auf nicht absehbare Zeit gesperrt sind. Hier bietet sich ein Feld für den sportgeschichtlich interessierten Nachwuchs.
Fast 40 Jahre nach dem Tod von Johann Marker kann ich einen Satz aus meinem Nachruf von 1985 wiederholen: „Klein war er nur von Gestalt, groß war er an Geist und Taten.“ So wird der Turnlehrer, Sportphilologe, Sprachwissenschaftler und Heimatforscher Johan Marker mir in Erinnerung bleiben.
Erstveröffentlichung 2025 in:
„Tintenturner und Turnphilologen“ –
Vorläufer einer modernen Sportwissenschaft.
Geschichte der Körperkultur in Studien und Materialien.
Band 4, arete-Verlag Hildesheim, 2025