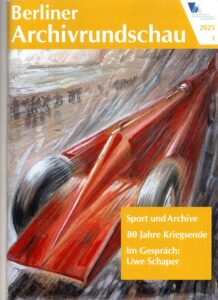Wer im Sport eine Jubiläumsschrift schreiben oder sich auch nur vergangener Wettbewerbe und Erlebnissen erinnern möchte, der braucht Archive. Man kann sagen, dass es ohne gesicherte Sportüberlieferungen und Sammlungen keine Sportgeschichte gibt. Der preußische Gelehrte Wilhelm von Humboldt hat das mit der Aussage „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“ bekräftigt.
Ein Beitrag zum 12. Symposium der Deutschen Arbeitsgemeinschaft von Sportmuseen, Sportarchiven und Sportsammlungen (DAGS) vom 30. September bis 2. Oktober 2025 im „Manfred-von-Richthofen Haus“ des Landessportbundes Berlin. Thema des Symposiums: Das Gedächtnis des Sports stärken – den sporthistorischen Diskurs fördern.
Seit mehr als 25 Jahren leistet die jährliche „Archivtagung“ des Landessportbundes Hessen in seiner Frankfurter Sportschule Pionierarbeit. War es zuerst ein überregionaler „Austausch zwischen den Ländern zur Archivarbeit im Sport“, spricht man heute von einer „Tagung zur Sicherung von Sportüberlieferungen“. Der langjährige Leiter des „Arbeitskreises Sport und Geschichte“ in Hessen, Peter Schermer, hat unverdrossen die Gründung von Vereins- und Verbandsarchiven und die Ernennung von Archivbeauftragten der Sportorganisationen gefordert. Dazu hat er hervorragende Dozenten und Wissenschaftler an den Main geholt. Ein großer Schritt war die Einrichtung einer Abteilung „Sportarchiv“ beim Landesarchiv des Saarlandes. Seitdem findet ein regelmäßiger Austausch mit dem Bundesarchiv und den Landes- und Kommunalarchiven statt. So ist eine Partnerschaft zwischen den professionellen Archiven und den im Sport ehrenamtlich Tätigen entstanden. Ziel ist es, das historische Erbe des Sports und damit der „Lebenswelt Sport“ dauerhaft zu sichern. Das „Hessische Modell“ hat die vernachlässigte Sportgeschichte und die dazu erforderliche Archivarbeit innerhalb der Sportorganisationen und des Amateursports auf Trab gebracht.
Inzwischen widmen sich ehrenamtliche Träger der Archivarbeit im Sport und machen den Versuch, sie als „Basics“ in die Alltagsaufgaben einzubeziehen. Ein schwieriges Unterfangen, lebt doch der schnelllebige Sport immer von der nächsten Weltmeisterschaft und Olympiade oder den anstehenden Wettkampfterminen. Da fällt es den Funktionären schwer, zurückzublicken und sich bereits ‚abgehakter‘ Veranstaltungen zu erinnern. Wenn bereits „Archivbeauftragte“ benannt sind, so müssen sie die Verantwortlichen zum Jagen tragen.
Seit 2003 gibt es die DAGS, die „Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Sportmuseen und Sportsammlungen“ der Bundesrepublik. Ihre Tagungen und Symposien sind richtungsweisend und stellen den Umgang mit der Vergangenheit des Sports in den Mittelpunkt. An ihrer Seite stehen in den Bundesländern außerhalb der Universitäten gegründete Foren und Institute, so in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Potsdam und Berlin, dazu die regional gebildeten und schon genannten Arbeitskreise. Sie leisten Kärrnerarbeit, da ganz allgemein nicht nur an den Universitäten die Sportgeschichte abgebaut wurde, sondern auch bei den Sportverbänden ein Umdenken erst langsam beginnt. Eine Herausforderung, vor der die DAGS und die regionalen Initiativen bis hin zu den Sammlungen der unterschiedlichsten Sportarten stehen. Sie schaffen es inzwischen auch, die durch die hessischen Vorleistungen geschaffenen Partnerschaften zu den staatlichen und kommunalen Archiven der Bundesrepublik weiter auszubauen. Dazu gehört auch der Berufsverband der Archivarinnen und Archivare. Ein 2008 stattgefundener Kongress der Kommunalarchive hat sich mit den „Lebenswelten Sport“ beschäftigt und den Sport erstmals den Bereichen Soziales, Gesundheit und Freizeit seiner Tätigkeiten zugeordnet. Die Kooperation ist besonders in den Flächenstaaten gewachsen, gehören doch der Sport und seine Vereine zum kulturellen und gesellschaftlichen Erbe der unterschiedlichen Regionen und Stämme der Bundesländer. Schwieriger wird es in den Großstädten, die durch Zuzug, Einwanderung und Zusammenlegung von ehemals selbstständigen Städten und Gemeinden entstanden sind.
Berlin geht auf eine Bevölkerung von 4 Millionen Bürgern zu, aus 21 Stadtbezirken sind zur Jahrtausendwende zwölf Verwaltungseinheiten geworden, deren ehemalige „Heimatmuseen“ äußerst zurückhaltend die neuen Strukturen annehmen und Schritt für Schritt frühere Archive vereinen. Seit 2011 gibt es Kontakte zwischen dem Landessportbund Berlin und dem Landesarchiv Berlin über die Abgabe von Vereins- und Verbandsbeständen sowohl an das Landesarchiv als auch das staatliche Sportmuseum. Die dafür nötigen finanziellen Ressourcen müssen allerdings geschaffen und in Sparhaushalten verteidigt werden, so hat es 13 Jahre gedauert, bis auch der Landessportbund seine archivwürdigenden Bestände abgeben konnte. Er setzt damit ein Zeichen für die 85 Verbände und 2.300 Sportvereine der Hauptstadt.
Durch das hessische Modell, dem inzwischen auch der Deutsche Fußball-Bund und weitere Verbände gefolgt sind, „lernen“ die Sportorganisationen den Umgang mit den Archiven und den nach zwei Diktaturen noch vorhandenen Dokumenten und Nachlässen. In Tagungen wird ihnen vermittelt, wo man was findet und welche Dokumente überhaupt „archivwürdig“ sind. Dazu gehört auch Eigeninitiative: Mir ist ein heute 92-jähriger Archivar aus Nordrhein-Westfalen, Hans-Günther Fascies, bekannt, der zum direkten Handeln auffordert: Auf roten Aufklebern hält er die Vorstände seiner Vereine an, ihre Akten und Dokumente an das Archiv des Westfälischen Turnerbundes abzugeben, und zwar mit den Sätzen „Wertvolles Archivmaterial, nicht wegwerfen! Bei Amtswechsel, Ausscheiden oder Tod an das Archiv der Jugendburg Oberwerries geben“. Mit einem kleinen ehrenamtlichen Team archiviert er die Akten und Protokolle der Vereine in Findbüchern und gibt sie in Schriftenreihen des parallel gegründeten „Westfälisch-Lippischen Instituts für Turn- und Sportgeschichte“ heraus. Sein vorbildliches Wirken führte beim Dachverband, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), zur Einrichtung eines Ressorts „Gedächtnis des Sports“, gefördert nach den jeweils finanziellen Möglichkeiten. Die Beschäftigung des Sports mit den professionellen und handwerklichen Tätigkeiten des Archivbereichs zeigt sich inzwischen auch in herausgegebenen Arbeitsmaterialen und wiederkehrenden Beiträgen in den Wissenschaftsportalen des Internets (s. Literaturliste).
Dass die Sportgeschichte heute kaum noch zum Angebot der Universitäten zählt, wird immer wieder beklagt. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Sportwissenschaft und der Geschichtswissenschaft stagniert, ein Zusammenwachsen zwischen West und Ost hat es nach der friedlichen Revolution nur vereinzelt gegeben. Ganz im Gegensatz dazu steht das große Interesse junger Menschen an zeitgeschichtlichen Vorgängen ihrer Sportarten und der persönlichen Beschäftigung mit Sportbiografien. Am 2020/21 zum Thema „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft“ mit dem Porträt des ermordeten Sintiboxers Roukelie Trollmann ausgeschriebenen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten haben sich 3.400 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Es gab 245 Landessieger und 250 Förderpreise. Das bedeutete intensive Archivarbeit, der Blick in Akten und Dokumente, Sitzen vor Mikrofilmlesegeräten alter Tageszeitungen, die Sammlung von noch vorhandenen Zeitzeugeninterviews. Der Blick ins Internet und zu Wikipedia war da nur ein bescheidener, erster Schritt für eigene Forschungen.
Ein oft gewähltes Thema war und ist die Erforschung der eigenen Vereinsgeschichte und der Entwicklung der persönlichen Lieblingssportarten. Wer hat die jüdischen Mitglieder 1933 ausgeschlossen, wer war Täter oder Opfer? Wie ist man mit den gegenüber der nachgeborenen Generation oft verschwiegenen Erinnerungen umgegangen und wer hat die alten Vereinszeitungen mit den Hakenkreuzen nicht nur vor der anrückenden Roten Armee verbrannt, sondern aus Selbstschutz vor seinen eigenen Durchhalteparolen und NS-Jubelartikeln entsorgt? Kann man das verlorengegangene Erinnern nach Jahrzehnten überhaupt noch nachholen? Ja, man muss.
Der Berliner Olympiapark ist zum Beispiel ein wahrer Abenteuerspielplatz der Sportgeschichte und Archivarbeit. Hier bemühen sich das Sportmuseum und die Bildungsstätte der Sportjugend sowie die landeseigene Olympiastadion GmbH um die Interpretation des schwierigen politischen Erbes aus mehr als einem Jahrhundert. Auch das Forum für Sportgeschichte, ein Mitgliedsverband des Landessportbundes, hat hier seinen Sitz und baut seit 2024 ein Kompetenzzentrum Sportgeschichte auf und tritt als Partner der Verbände und Vereine auf.
Aber auch innerhalb der Stadt haben viele Sportstätten und Turnhallen ihre eigene, oft vergessene Geschichte. Wo suchten die jüdischen Sportvereine bis 1938 Zuflucht zum Sporttreiben, wo entstanden Barackenlager für Zwangsarbeit? Wie kontextualisiert man das? Arbeit mit und in Archiven bedeutet Auswertung von Tageszeitungen, Studium von Finanz-, Register- und Bauakten, Gerichtsurteilen und dem Blick in die im Landesarchiv zu Hunderttausenden aufbewahrten polizeilichen Meldekarteien. Hinzu kommen die Missbrauchs- und Ausgrenzungsfälle des Sports, wer war ausgeschlossen, wurde denunziert oder wer war – aus der jüngsten Geschichte – von Stasi- und Doping betroffen? Ein weites Feld, nicht nur der Museumspädagogik. Der Berliner Fußball-Verband wird im April 2025 sein Projekt zur NS-Belastung in der Nachkriegszeit vorstellen, die Sportjugend geht mit einer Neuauflage von „Mit dem Davidstern auf der Brust“ den Spuren der jüdischen Sportjugend von 1898 bis 1938 nach. Auch der Landessportbund bereitet ein Forschungsvorhaben zu seiner Geschichte nach 1945 vor. Da ist einiges in Bewegung. Der Bestseller-Autor Volker Kutscher hat für seine zehnbändigen Kriminalromane um Gideon Rath – die Vorlage für die Fernsehserie Babylon-Berlin – zwanzig Jahre in den Archiven und Bibliotheken recherchiert. Welcher Journalist investiert heute ähnlich viel Zeit in seine Recherchen und setzt sich stundenlang vor die Mikrofilmlesegeräte und verzichtet damit auf das Internet und Künstliche Intelligenz?
Ein in den letzten Jahren stattgefundene Zeitenwende stellt die Archivarbeit vor große Probleme – die Digitalisierung. Das ist ein Thema für sich. Digitale Medien haben nur eine geringe Lebensdauer, ganz im Gegensatz zu seit über 500 Jahren erhaltenen Dokumenten und Büchern aus Papier. Wer über die Geschichte seines Vereins und große Sportereignisse schreiben will, findet in den Archiven noch papierne Zeugnisse, muss aber immer öfter auf digitale Medien und das weltweite Web zurückgreifen. Eine zentrale Cloud des Deutschen Olympischen Sportbundes unter dem Namen „Archiv des Sports“ sucht der Rechercheur vergebens. Wäre es nicht an der Zeit, die wichtigen Dokumente des Sports, z.B. Jahresberichte, Verbands- und Vereinszeitungen, Festschriften, Plakate und Chroniken, aber auch Bild- und Tondokumente wie Interviews und Zeitzeugenberichte in einer deutschlandweiten Cloud der Nachwelt zu erhalten? Dieser Herausforderung sollten sich das Bundesinstitut für Sportwissenschaft, die Deutsche Sporthochschule in Köln und der Deutsche Olympische Sportbund (DODB) mit seinen Mitgliedsverbänden stellen. Das wäre ein Gewinn für die Erinnerungskultur des Amateursports, der uns gesellschaftlich zusammenhält und die größte Bürgerinitiative in Deutschland ist. Der Sport braucht seine Archive, seine eigene „Wolke“. Wer macht den Anfang für eine bundesweite Sport-Cloud?
Literaturhinweise
Sicherung von Sportüberlieferungen. Bd. 1 Sachstandsberichte und Perspektiven. Bd. 2 Recherche, Netzwerke und (Ausstellungs-)Projekte. Herausgeber: Verband Deutsche Archivarinnen und Archivare, Deutsche Sporthochschule Köln, Landessportbund Hessen. Agon (2017/2022).
Martin Ehlers: Sportgeschichte vernetzt. Jubiläumssymposium der DAGS und des IfS Baden-Württemberg, Maulbronn (2013)
Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg (IfS): Sammeln, Archivieren, Auswerten – ein Leitfaden für Vereinsarchive, Festschriften und Jubiläumsausstellungen. Maulbronn (2010)
Pauline Puppel: Sportgeschichte(n) bewahren – zum Erhalt von Schrift- und Bildgut. Deutscher Fußball-Bund. Frankfurt/M. (2010)
Peter Schermer: Archivarbeit im Sport – das hessische Model. Power-Point-Präsentation des LSB Hessen unter www.Archivarbeit_im_Sportverein.pptx. (2024)