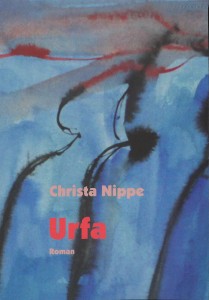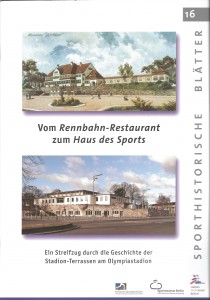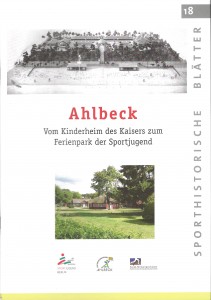Manfred Nippe
Vita: Geboren und tätig in Berlin, Jahrgang 1941, verwitwet, 1 Tochter, 2 Enkelkinder. Mittlere Reife und Höhere Wirtschaftsschule in Berlin. Berufliches: von 1961 bis 1966 Sozialversicherungs-Angestellter bei der AOK Berlin, von 1967 bis 1970 Jugendsekretär des Deutschen Turnfestes Berlin 1968 und des Berliner Turnerbundes. Von 1970 bis 2000 Jugendreferent des Landessportbundes Berlin und Hauptamtliches Vorstandsmitglied der Sportjugend Berlin. Danach bis zum Ruhestand 2006 Referent für Sportentwicklung des LSB Berlin. Von 1992 bis 2013 auch Geschäftsführer und Berater der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft „Sport für Berlin“. Hobbies: Sport- und Zeitgeschichte, Fotografieren, Lesen, jetzt auch Küche und Garten.
Ehrenamtliche Tätigkeiten: Übungsleiter, Lehrwart, Jugendleiter und Pressewart des TuS Neukölln (1955 – 1975), Vorsitzender der Sportjugend Neukölln (1964 – 1971) und des Bezirksjugendringes Neukölln (1965/1968), Mitglied des Jugendwohlfahrtsausschusses Neukölln (1965 – 1971), Vertreter der Sportjugend im Presseausschuss des Landesjugendringes/Zeitschrift ‚Blickpunkt‘ (1965 – 1970), Vorstandsmitglied der Sportjugend Berlin (1967 – 2000), Fachausschuss Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Sportjugend (1969 – 1978), Schriftleiter der Berliner Turnzeitung (1969 – 1973) und Landespressewart des Berliner Turnerbundes (1973 – 1979), Pressechef der 6. Gymnaestrada Berlin 1975, Vertreter des Sports im Landesjugendhilfeausschuss Berlin (1970 – 2000), Geschäftsführer der Landessportkonferenz Berlin (1974 – 1978), Vorsitzender des Landesjugendringes Berlin (1975/76, 1985/86), Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Sportbeirats beim Landesvorstand der SPD (1976 – 1991), Beauftragter für den deutsch-türkischen Sport- und Jugendaustausch ‚Berlin-Istanbul‘ (1983 – 2000), Wirtschaftsinitiative ‚Impulse der 80er Jahre‘ (1985 – 1989), Gründungsmitglied, Vorsitzender und stellv. Vorsitzender der ‚Werkstatt der Kulturen‘ in Berlin (1985 – 2000), Stellv. Vorsitzender des Vereins zur Förderung des deutsch-türkischen Sportjugendaustausches in Frankfurt/Main (1987 – 1990), Ad-hoc-Kommission der DSJ für die Neuen Bundesländer (1990 – 1994). Seit 2005 Vizepräsident des Forums für Sportgeschichte Berlin und seit 2007 Beauftragter für Sportgeschichte des Landessportbundes Berlin.
Ehrungen: Ehrenurkunde des Bezirksamtes Neukölln (1969) und Paracelsus-Medaille des Bezirksamtes Reinickendorf (1995), Silberne und Goldene Ehrennadel des TuS Neukölln (1973/1990), Silbernes Eichenblatt (1974) und Zeus-Medaille in Gold der Sportjugend Berlin (2000), Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes und der Deutschen Olympischen Gesellschaft (1977/2007), Diskus der Deutschen Sportjugend (1978), Ehrenschild des Türkischen Generalkonsulates (1991), Bundesverdienstkreuz (2007), Silberne Ehrennadel des VfL Berliner Lehrer (2011), Ehrenmitglied des Landessportbundes Berlin (2021).

Mitgliederversammlung vom 26.8.2021. Fotos: LSB Berlin/Jürgen Engler