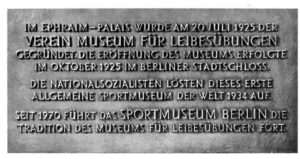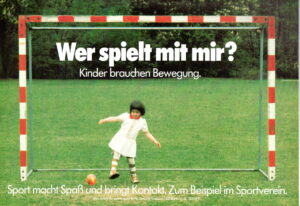Der 1984 im Alter von 87 Jahren in Berlin verstorbene Turnlehrer Johann Marker war seit Ende der zwanziger Jahre ein bekannter Sportautor. Er widmete sich besonders dem Grundschulsport der Kinder und dem Ballspiel, trat aber auch als „Wissenschaftsjournalist“ an die Öffentlichkeit. Mehr als 80 Veröffentlichungen in Fachzeitschriften sowie fünf Bücher verzeichnen die Bibliografien (s. Anlage). Dazu gehören auch Beiträge zur Sprachwissenschaft und nach dem Krieg zur Berliner und Brandenburger Geschichte. An ihn soll erinnert werden.
Johann Marker wurde am 29. November 1896 in Charlottenburg geboren. Sein Vater Karl Marker war Maurer, seine Mutter Maria, geb. Schöpe, Verkäuferin. Er hatte eine ältere Schwester Margarethe und zwei jüngere  Hedwig und Magdalena, alle waren katholischer Konfession. Die Familie wohnte in der Schillerstr. 79 in Charlottenburg, das damals noch selbständige Stadt war. Er besuchte dort die 242. Gemeindeschule und erhielt 1911 sein Entlassungszeugnis. Noch vor Ausbruch des 1. Weltkrieges zog die Familie nach Fraustadt (heute: Wschowa) in der preußischen Provinz Posen. Dort schrieb sich Johann Marker 1914 in das Königliche Lehrerseminar mit dem Berufsziel des Volksschullehrers ein. 1917 wurde er trotz seiner geringen Körpergröße zum Lehrgang für Kriegsseminaristen einberufen und als Unteroffizier dem Füsilier-Regiment 39 zugewiesen. 1919 folgte seine Entlassung aus dem Wehrdienst. Er setzte das Lehrerstudium in Fraustadt fort und bestand dort im November 1919 die Erste Staatsprüfung. Danach wechselte er nach Berlin-Lichterfelde und erhielt 1920 nach dem Zweiten Staatsexamen das Zeugnis zur Anstellung als Lehrer an Volksschulen.
Hedwig und Magdalena, alle waren katholischer Konfession. Die Familie wohnte in der Schillerstr. 79 in Charlottenburg, das damals noch selbständige Stadt war. Er besuchte dort die 242. Gemeindeschule und erhielt 1911 sein Entlassungszeugnis. Noch vor Ausbruch des 1. Weltkrieges zog die Familie nach Fraustadt (heute: Wschowa) in der preußischen Provinz Posen. Dort schrieb sich Johann Marker 1914 in das Königliche Lehrerseminar mit dem Berufsziel des Volksschullehrers ein. 1917 wurde er trotz seiner geringen Körpergröße zum Lehrgang für Kriegsseminaristen einberufen und als Unteroffizier dem Füsilier-Regiment 39 zugewiesen. 1919 folgte seine Entlassung aus dem Wehrdienst. Er setzte das Lehrerstudium in Fraustadt fort und bestand dort im November 1919 die Erste Staatsprüfung. Danach wechselte er nach Berlin-Lichterfelde und erhielt 1920 nach dem Zweiten Staatsexamen das Zeugnis zur Anstellung als Lehrer an Volksschulen.
In den Hungerjahren und der großen Arbeitslosigkeit entschied er sich für eine Fortsetzung des Studiums. Er besuchte die Preußische Hochschule für Leibesübungen (Landesturnanstalt) in Spandau und machte 1922 nach einjähriger Ausbildung das Diplom als Turn-, Schwimm- und Ruderlehrer. 1923 erhielt er von der staatlichen Prüfungskommission die Befähigung zur Tätigkeit als Mittelschullehrer und besuchte in Spandau Fortbildungen im orthopädischen Turnen. Im staatlichen Lehrerseminar Berlin-Lichterfelde belegte er 1925/26 Ergänzungskurse in Latein und Griechisch, die 1927 zum Reifezeugnis führten. Er war nunmehr bestens für den Schuldienst und ein Universitätsstudium ausgebildet, hatte aber keine Chance auf Anstellung. So immatrikulierte er sich 1926 an der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin, der heutigen Humboldt-Universität.