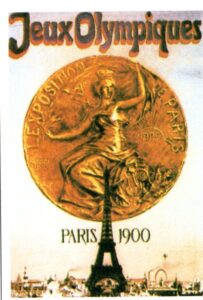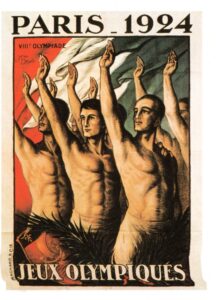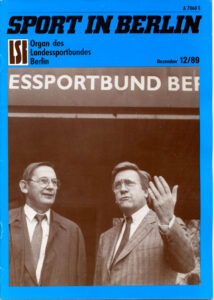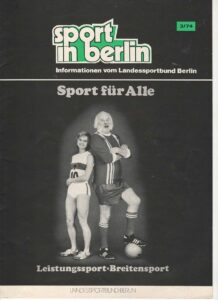SPORTGESCHICHTE(N) in „Sport in Berlin“
Paris ist zum dritten Mal Ausrichter von Olympischen Spielen, erstmals auch der Paralympics. Wir erinnern uns an die Sommerspiele von 1900 und 1924.
Olympische Spiele Paris 1900
Pierre de Coube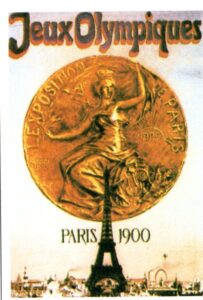 rtin, Begründer der modernen olympischen Spiele, wollte zu den ersten Spielen anlässlich der Weltausstellung nach Paris im Jahr 1900 einladen. Die Begeisterung in Europa für das antike Griechenland, hochherzige Spender und der Bau des Athener Stadions führten aber bereits 1896 zur Premiere in Athen. Paris war vier Jahre später an der Reihe. Das Internationale Olympische Komitee sprach ein Machtwort aus, weil Griechenland die Spiele auf ewig behalten wollte und vergab sie an Coubertins Heimatland.
rtin, Begründer der modernen olympischen Spiele, wollte zu den ersten Spielen anlässlich der Weltausstellung nach Paris im Jahr 1900 einladen. Die Begeisterung in Europa für das antike Griechenland, hochherzige Spender und der Bau des Athener Stadions führten aber bereits 1896 zur Premiere in Athen. Paris war vier Jahre später an der Reihe. Das Internationale Olympische Komitee sprach ein Machtwort aus, weil Griechenland die Spiele auf ewig behalten wollte und vergab sie an Coubertins Heimatland.
An den 2. Olympischen Spielen in Paris nahmen 1500 Männer und 20 Frauen aus 23 Ländern in 24 Sportarten teil. Völkerverbindend waren sie kaum, da sie während der Weltausstellung von Mai bis Oktober an unterschiedlichsten Orten – vom Bois de Boulogne (Leichtathletik) bis zur Seine (Schwimmen) – stattfanden. So kam die „Jugend der Welt“ nur zufällig zusammen, zumal parallel noch Wettbewerbe für Profiathleten ausgetragen wurden. Zum Ärger von Coubertin interessierte sich die Öffentlichkeit kaum für die Spiele. Erst 1908 konnte er deren Eigenständigkeit in London durchsetzen. Die deutschen Olympiasieger von 1896 waren wegen der ihnen verbotenen Teilnahme in Athen von der Deutschen Turnerschaft für Paris gesperrt. Hermann Weingärtner (TV Frankfurt/Oder, Berliner Turnerschaft) blieb mit sieben Medaillen der erfolgreichste Olympionike seiner Zeit.
Bekanntester Athlet in Paris 1900 wurde Alvin C. Kraenzlein (USA) mit vier Medaillen in der Leichtathletik über 60 m, 110 und 200 m Hürden und im Weitsprung. Er wurde 1913 von Carl Diem als Reichstrainer und Hürden-Spezialist nach Berlin geholt und kehrte bei Ausbruch des 1. Weltkrieges in die USA zurück. Fußball war in Paris das erste Mal dabei, es siegte Großbritannien vor Frankreich und Belgien. Der Deutsche Fußballbund war noch keine Größe, er wurde gerade erst in Leipzig gegründet.
Erstmals nahmen 20 Frauen an den Spielen teil, im Golf, Tennis, Segeln und Ballonfahren. Das damals beliebte Tauziehen stand 1900 für zwanzig Jahre auf dem olympischen Programm, vielleicht erlebt es eine Wiedergeburt im zukünftigen Berliner Sportmuseum als Retrolympics. Im Hoch-, Weit- und Dreisprung wurde auch aus dem Stand gesprungen. Deutschland errang zwei Olympiamedaillen im 200 m Rückenschwimmen, eine für die Mannschaft, die andere für den Bremer Ernst Hoppenberg im Einzel.
Olympische Spiele Paris 1924
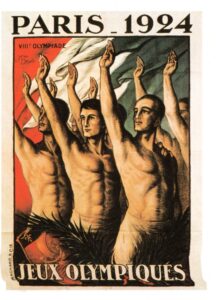
Mit den Olympischen Ringen auf eigener Fahne, einem olympischen Dorf für die Aktiven und den ersten Reportagen über den Rundfunk lud Frankreich 1924 erneut nach Paris ein.
Deutschland war seit 1920 auf Grund des 1. Weltkrieges ausgeschlossen. 3000 Männer und 150 Frauen aus 140 Ländern und 45 Sportarten waren vom 4. Mai bis 27. Juli nach Paris gekommen. Die Stars der Spiele waren die „fliegenden Finnen“ Paavo Nurmi mit fünf und Ville Ritona mit vier Goldmedaillen in der Leichtathletik sowie Johnny Weissmüller (USA) – der spätere Tarzan – als dreifacher Olympiasieger im Schwimmen. Die Frauen waren mit 10 Goldmedaillen im Schwimmen, Fechten und Tennis dabei.
Im Schießen nahm man Tontauben und den „laufenden Hirsch“ ins Visier.
Zu den Sportarten im Turnen zählte noch „Tauhangeln“ am bis zu 12 Metern hohen Seil. 2024 steht Klettern, wenn auch nicht mehr am Seil, auf dem Programm. In der Bundesrepublik gehören Kletterseile im Gegensatz zu Österreich nicht mehr zur Standardausrüstung von Schulturnhallen. Neu ist in Paris 2024 das Breaking, wer hätte gedacht, dass Breakdance als Ausdruck der Jugendkultur ins olympische Programm aufrückt.
Die Geschichte der Olympischen Spiele ist voller dramatischer und berührender Erlebnisse, sie zeigt aber auch ein permanentes Streben nach einer Weiterentwicklung des Sports und seiner Sportarten. Hier setzt das in den Medien oft gescholtene IOC auf Modernität und Nachhaltigkeit. In kriegerischen Zeiten und globalen Welten eine Stimme zum Frieden.
Erstveröffentlichung
in „Sport in Berlin“,
Ausgabe 4 – 2024